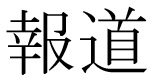Es ist uns einfach so lang so gut gegangen. Zu gut gegangen. Sagt meine Mutter, mit der Betonung auf ZU. Sie lebt in Salzburg, ich in Niederösterreich. Ich rufe sie in diesen Tagen öfter an als vorher. Nicht mehr nur am Samstag. Ihr Leben hat sich wenig verändert. Die Heimhelferinnen tragen jetzt Schutzkleidung. Der Zusteller von „Essen auf Rädern“ hält Abstand und nimmt kein Bargeld mehr. Der Fußpflegetermin ist abgesagt worden. Mutter klingt jetzt fröhlicher als vorher. So viele Nachbarinnen haben ihr ihre Hilfe angeboten! Der Bundespräsident hat so schön und respektvoll von den alten Menschen gesprochen! Auch der Bundeskanzler mache sich sehr gut, findet sie. Mit meinen Schwestern tausche ich Blumenbilder via WhatsApp aus. Ich beginne den Tag mit einem Foto von der eben aufgeblühten rosa-weißen Kamelie im Garten. Die Jüngere, im hunderte Kilometer entfernten Home-Office in Deutschland, möchte gerne bald telefonieren. Sie fühle sich ein wenig isoliert. Sie darf nicht mehr nach Österreich einreisen.
Japan ersucht alle Reisenden aus Europa, Ägypten und dem Iran, sich 14 Tage unter Selbst-Quarantäne zu stellen. Die ersten findigen Hotelbesitzer bieten günstige Zimmer an. Wer will jetzt ausgerechnet nach Japan?! Mein Ticket nach Tokyo für Juni habe ich vorsorglich schon lange davor gebucht. Weil doch zu erwarten war, dass die Preise rund um die Olympischen Spiele in die Höhe schnellen würden. Auch mein Lieblingshotel in Tokyo ist vorreserviert. Und nun gibt es diesen neuen, unsichtbaren Feind, der sich ausbreitet. Ich denke an Fukushima. An die Menschen, die sich an das Leben mit einer unsichtbaren Gefahr gewöhnt haben. Oder davor geflüchtet sind. Vor Corona kann jetzt keiner mehr flüchten. Geschlossene Geschäfte, leere Plätze. Menschen mit Masken. Die Aufforderung, daheim zu bleiben und Kontakte zu meiden. Im dekontaminierten Fukushima immer noch Hot-Spots, nach neun Jahren. Da ein Atomkraftwerk, das in die Luft geflogen ist und winzige radioaktive Partikel ausgestreut hat. Dort ein Virus, das sich in feinen Aerosolen über uns breitet und in uns eindringt. Man sieht es nicht, man hört es nicht, man riecht es nicht. Die Radioaktivität ist nicht übertragbar. Man-made disaster, in beiden Fällen. Wildtiere am Speiseplan in der chinesischen Provinz, Ballermann und Komasaufen in den Tiroler Bergen. Keine Naturkatastrophen. Ich esse keine Tiere. Die, die mit uns leben, sind mir jetzt wichtiger denn je.
Die gute Nachricht kommt am späten Nachmittag. Endlich ruft E. an. Er und seine Frau R. haben seit vier Jahren auf einen Asylbescheid gewartet. Jetzt ist er da. Positiv. Eine Sorge fällt weg. Bald wird R. ihr zweites Kind bekommen. E. und R. haben die letzten Monate fast durchgehend im St. Anna Kinderspital verbracht. Ihr dreijähriger Sohn wartet auf eine Knochenmarktransplantation. Er hat Leukämie.
Schriftsteller-Freund*innen schicken mir Texte und Links zu ihren YouTube-Auftritten. Die älteste von ihnen, Jahrgang 1923, telefoniert lieber. Sie fühle sich an das Frühjahr 1945 erinnert, kurz nach der Befreiung, an die Unsicherheit über die Frage, wie es weitergehe würde. Der Antrag meiner Mutter auf Erhöhung der Pflegestufe ist abgelehnt worden. Es fehlen vier Stunden Pflegedarf. In einem Jahr darf sie, die heuer 83 geworden ist, einen neuerlichen Antrag stellen. Sie nimmt es mit erstaunlicher Gelassenheit.